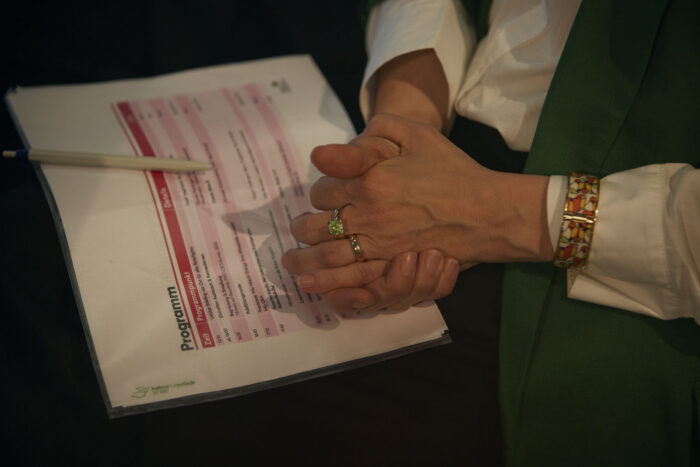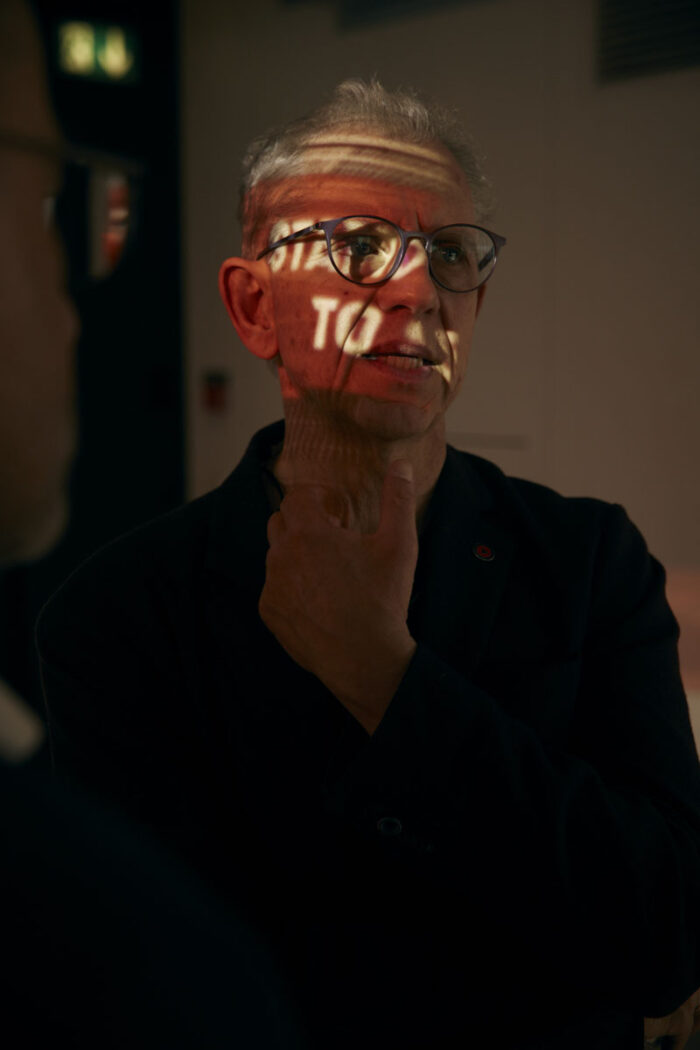Was bedeutet es konkret, Emissionen in Scope 3 zu reduzieren? Darüber haben sich rund 60 CEOs von Grossunternehmen aus allen Branchen am CEO4Climate-Erfahrungsaustausch vom 15. April bei PwC Switzerland ausgetauscht – zusammen mit hochkarätigen Referent*innen und Expert*innen.
Die teilnehmenden CEOs bekannten sich im Rahmen des Anlasses zur Umsetzung konkreter Massnahmen, um die Reduzierung ihrer Scope-3-Emissionen voranzutreiben. Dazu gehören Gespräche mit den wichtigsten Lieferanten, Workshops mit der Geschäftsleitung zu Scope-3-Potentialen oder die Prüfung von Kooperationen über die Wertschöpfungskette hinweg (analog dem vorgestellten Modell AgroImpact)






Fotografie: Maurice Haas
Weitere Bilder finden Sie am Ende dieses Beitrags.
Key Community Insights des Erfahrungsaustauschs
- Das Commitment bleibt hoch
Das Umfeld, um die eigenen Klimaziele zu erreichen, ist für rund 60% der CEO4Climate-Mitwirkenden im letzten Jahr anspruchsvoller geworden. Dennoch sagten nur 13%, es sei für sie heute deutlich schwieriger, zu ihren Commitments zu stehen. Kein CEO gab an, die Ziele abgeschwächt zu haben. - CEOs sind entscheidend für die Reduktionen in Scope 3
Für viele Unternehmen machen die Emissionen, die bei der Produktion von eingekauften Gütern oder beim Einsatz der verkauften Produkte bei Kunden entstehen, den grössten Teil des Footprints aus. Bei Schweizer Firmen, die sich Ziele gemäss der Science Based Targets Initiative gesetzt haben, liegt denn auch der Anteil der Emissionsreduktionen im Scope 3 bei rund 80%. Um diese Ziele zu erreichen, ist das Involvement der CEO entscheidend. Es braucht die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit Mittbewerbern, zu Co-Investing in Massnahmen von Lieferanten (Reduktion der Emissionen von «purchased goods & services») und zu Innovationen bei den Angeboten (Reduktion der Emissionen der «sold products»). Die Zusammenarbeit mit dem CSO ist dabei sehr wichtig. - Scope 3 als Innovationstreiber
Andreas Schierenbeck, CEO von Hitachi Energy zeigte mitunter auf, wie das Isoliergas SF6 bei Transformatoren einen sehr hohen Anteil der Scope-3-Emissionen von Hitachi Energy ausmacht, da sich SF6 stark auf das Klima auswirkt (Wirkung von 0,6% der globalen Emissionen). Das Hitachi Management hat deshalb in die Entwicklung der SF6-freien Alternative EconiQ investiert und damit Erfolg am Markt. - Zusammenarbeit über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg zentral
Das Kooperationsmodell von AgroImpact kann Antworten zur Klärung der Kostenträger für die Dekarbonisierung liefern. AgroImpact treibt die CO2-Reduktion in der Landwirtschaft voran und hat ein Finanzierungsmodell entwickelt, welches Landwirte, Retailer und Lebensmittelhersteller zusammenbringt. Julia Baumann von Lidl Schweiz inspierierte viele Teilnehmende, sich ähnliche Gedanken für ihre Branche zu machen. - Regulierung wird zu mehr Transparenz führen
Auch wenn die EU die Scopes der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) und der corporate sustainability due diligence (CSDD) anpasst, werden viele Firmen einen Climate Transition Plan erstellen. Dieser wird helfen, Scope-3-Emissionen bei der Evaluation von Lieferanten konsequenter zu berücksichtigen.
CEO Hitachi Energy
Im Zentrum des Events standen diese fünf Breakout Sessions:
Zusammenarbeit über die Lieferkette hinweg
Beispiel AgroImpact – was können andere Branchen davon lernen?
Community Insights
- Kooperationen entlang der Wertschöpfungskette haben ein grosses Potenzial, um die Scope-3-Emissionen in der Lieferkette zu reduzieren. Das Beispiel von AgroImpact kann dabei auch andere Branchen inspierieren: AgroImpact treibt die CO2-Reduktion in der Landwirtschaft voran und hat ein Finanzierungsmodell entwickelt, welches Landwirte, Retailer und Lebensmittelhersteller zusammenbringt.
- Entscheidend für die Etablierung solcher Modelle ist eine präkompetitive Diskussionskultur, die die Zusammenarbeit über die Lieferketten hinweg überhaupt erst ermöglicht. Voraussetzung für solche Kooperationen sind Vertrauen und der Wille zur gemeinsamen Zielverwirklichung.
- Die Rolle der CEOs wurde diesbezüglich als besonders wichtig beurteilt. Sie müssen als «Ermöglicher» agieren, indem sie den partnerschaftlichen Gedanken in den Vordergrund stellen. Sie sollten die Chancen von Kooperationen vermitteln und den Dialog mit Verbänden sowie Plattformen suchen.
- Eine wesentliche Frage ist oft, wer die Initiative zu einer branchenübergreifenden Zusammenarbeit ergreift, insbesondere wenn es um finanzielle Vorleistungen geht. Branchen(-übergreifende) Verbände könnten hier eine entscheidende Rolle übernehmen, indem sie als Mittler und Gastgeber fungieren.
Leiterin Nachhaltigkeit Lidl Schweiz
Zusammenspiel CEO und Nachhaltigkeitsverantwortliche
Was bewährt sich – mit Blick auf Scope 3 und allgemein?
Community Insights
- Idealerweise sind Nachhaltigkeitsverantwortliche Geschäftsleitungsmitglieder oder Teil des erweiterten Führungskreises und stehen im regelmässigen Austausch mit dem CEO. Gerade mit Blick auf Kooperationen oder auf Gespräche mit strategischen Lieferanten oder Kunden ist diese organisatorische Verankerung wichtig.
- CEOs sollten fähig sein, Spannungsfelder zwischen langfristigen Nachhaltigkeitszielen und kurzfristigen Renditezielen zu akzeptieren und diese Themen transparent diskutieren. Dies fördert eine offene Lernkultur im Umgang mit Zielkonflikten, die beispielsweise in Zusammenarbeit mit Lieferanten (höhere Kosten vs. Emissionsreduktionen) entstehen können.
- Eine glaubwürdige und transparente Vorgehensweise des CEOs ist notwendig, um die gesamte Geschäftsleitung mitzunehmen. Gemeinsame, bereichsübergreifende Ziele für die Geschäftsleitungsmitglieder – gekoppelt an Vergütungselemente – haben eine hohe Wirkung.
- Nachhaltigkeitsverantwortliche benötigen sowohl Durchsetzungsvermögen («Steher-Qualitäten») als auch Umsetzungsfähigkeiten («Macher-Qualitäten») und sollten in der Lage sein, über alle Hierarchieebenen hinweg zu kommunizieren.
Umsetzung von Science based Targets
Erfolgsfaktoren bei der Erreichung von Scope-3-Zielen von Unternehmen
Community Insights
- Die Science Based Targets Initiative (SBTi) ist der Standard, der sowohl Verbindlichkeit schafft als auch die Beziehungen zwischen Kunden und Lieferanten beeinflusst.
- Weil jedoch insbesondere kleine Kunden kaum Marktmacht besitzen, ist der Einfluss auf deren Lieferanten gering, während die Marktmacht der eigenen Kunden unter Umständen sehr stark sein kann. Entsprechende Interessenskonflikte (Kundenorientierung vs. Lieferantenorientierung) müssen frühzeitig adressiert werden.
- SBTi trägt zwar zur Verbesserung der Sichtbarkeit und zur effektiven Kommunikation von Emissionszielen bei, bietet jedoch keine direkten Lösungen oder konkrete Massnahmen.
- Die öffentliche Beschaffung ist eine Chance, um grüne Leitmärkte für dekarbonisierte Produkte zu schaffen. Ausschreibungen konzentrieren sich dabei auf zentrale Aspekteund orientieren sich an Standards wie SBTi, was auch die Verwaltung zur intensiveren Zusammenarbeit mit anderen Beschaffungsakteuren anregt.
Projektleiter Klimaziele für Unternehmen Go for Impact
Scope 3 und Regulierung
Wie schaffen wir unternehmerischen Mehrwert durch die kommende Regulierung?
Community Insights
- Aufgrund der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) und der corporate sustainability due diligence (CSDD) werden – trotz der Reduktion des Scopes dieser Regelwerke im Rahmen der Omnibus-Anpassungen – viele Firmen Climate Transition Plans erstellen, die den Businessplan ergänzen. Diese bieten eine gute Grundlage für die Transparenz entlang der Wertschöpfungskette.
- Anstelle des gesamten Corporate Footprints ist es von Vorteil, den Product Footprint zu betrachten, da dieser in den Scope 3 des Käufers einfliesst; Verkäufer sollten die Ziele ihrer Käufer gut kennen und eine Bestellkompetenz entwickeln, die auf einem soliden Climate Transition Plan und dem richtigen CO2-Preis basiert.
- Es ist entscheidend, CO2-Emissionen zu messen und einen Preis dafür festzulegen, um den wirtschaftlichen Nutzen einer Einsparung zu betonen.
- Der öffentlichen Hand kommt eine besondere Rolle zu, wenn es darum geht, nachhaltige Beschaffungspraktiken zu etablieren. Es ist entscheidend, die richtigen Anforderungen zu formulieren und diese angemessen zu gewichten, um einen positiven Einfluss auf die gesamte Lieferkette zu erzielen.